3 Minuten
Die Definition von Leben überdenken: Wissenschaft am Wendepunkt
Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Frage, was Leben eigentlich ausmacht. Die etablierten Definitionen umfassen problemlos komplexe mehrzellige Organismen und einfache, sich selbst replizierende Bakterien. Dennoch bleiben bestimmte Entitäten wie Viren, die für ihre Vermehrung einen Wirt benötigen und keinen eigenen Stoffwechsel besitzen, an der Peripherie dieser Definitionen. Das besondere Verhalten von Viren – äußerst aktiv im Wirt, außerhalb jedoch inaktiv – sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen in den Bereichen Genetik, Mikrobiologie und Evolutionsbiologie.
Entdeckung von Sukunaarchaeum mirabile: Eine Zwischenform des Lebens
Die klassischen Grenzen der Lebensdefinition infrage stellend, haben Forscher aus Kanada und Japan ein neuartiges Mikroorganismus entdeckt, das in einer aktuellen Studie auf dem Preprint-Server bioRxiv beschrieben wird. Das vorläufig Sukunaarchaeum mirabile genannte Mikrobenwesen vereint Merkmale sowohl zellulärer Organismen als auch von Viren und eröffnet so einzigartige Einblicke in die Grauzone zwischen Leben und Nicht-Leben.
Benannt nach einer kleinen Gottheit aus der japanischen Mythologie, wurde Sukunaarchaeum mirabile bei genomischen Analysen des Meeresplanktons Citharistes regius entdeckt. Während der Untersuchung des genetischen Materials entdeckte Dr. Ryo Harada mit seinem Team von der Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia, ein auffälliges DNA-Fragment, das mit keiner bekannten Spezies übereinstimmte. Weitere Analysen ergaben eine Zugehörigkeit zur Domäne Archaea – urtümliche Mikroorganismen, die als gemeinsame Vorfahren aller Eukaryoten, einschließlich des Menschen, gelten.
Genomstruktur: Ein minimalistischer Bauplan des Lebens
Besonders bemerkenswert an Sukunaarchaeum ist sein stark verkleinertes Genom mit lediglich 238.000 Basenpaaren. Zum Vergleich: Viele Viren verfügen über deutlich größere Genome, teils im Millionenbereich. Sogar innerhalb der Archaeen sind die bislang kleinsten bekannten vollständigen Genome über 490.000 Basenpaare – mehr als doppelt so groß wie das von Sukunaarchaeum.
Im Gegensatz zu typischen Viren besitzt dieser Organismus die Gene zur Herstellung eigener Ribosomen und von Messenger-RNA, was auf eine gewisse Eigenständigkeit hindeutet. Allerdings fehlen fast alle klassischen Stoffwechselwege, sodass Sukunaarchaeum für grundlegende biologische Funktionen abseits der DNA-Replikation, Transkription und Translation umfassend auf seinen Wirt angewiesen ist. Die Forscher halten fest: „Sein Genom ist radikal reduziert, praktisch frei von erkennbaren Stoffwechselwegen und kodiert vorrangig die Komponenten seines Replikationsapparats – DNA-Replikation, Transkription und Translation.“
Eine neue Perspektive auf zelluläre Abhängigkeit
Diese Mischung aus teilweiser Eigenständigkeit und extremer Abhängigkeit ist bislang einmalig. Indem Sukunaarchaeum lediglich die Gene für die Selbstreplikation behält und sämtliche andere Stoffwechselprozesse auf den Wirt auslagert, hinterfragt es die bisherigen Unterscheidungen zwischen minimalistischem zellulärem Leben und Viren. Wie die Autoren schreiben, sprengt dieses Maß an metabolischer Abhängigkeit „die konventionellen Grenzen zellulären Lebens“ und verweist auf eine bislang weitgehend unerforschte Vielfalt mikrobieller Symbionten.
Folgen für die Evolutionsbiologie und die Erforschung mikrobiellen Lebens
Die Entdeckung von Sukunaarchaeum mirabile eröffnet neue Forschungsrichtungen in der mikrobiellen Ökologie, der evolutionsbiologischen Genetik und der Ursprungsforschung des Lebens. Dieser Organismus steht beispielhaft für einen Zwischenschritt zwischen viralen und zellulären Lebensstrategien und deutet darauf hin, dass es noch zahlreiche weitere Formen solcher Grenzgänger in der Natur geben könnte. Die Ergebnisse stellen unsere bisherige binäre Einordnung von Leben infrage und verdeutlichen die Komplexität biologischer Evolution.
Wie das Forschungsteam betont: „Weitere Untersuchungen symbiotischer Systeme könnten noch außergewöhnlichere Lebensformen enthüllen und unser Verständnis zellulärer Evolution grundlegend verändern.“
Fazit
Die Identifizierung von Sukunaarchaeum mirabile ist ein bedeutender Schritt beim Versuch, die Grenzen des Lebens neu zu definieren. Das außergewöhnliche Mikrobenwesen verwischt die Trennlinien zwischen Zellen und Viren, fordert bestehende Grundannahmen heraus und weist auf eine breitere, differenziertere Sicht auf mikrobielle Vielfalt hin. Zukünftige Studien zu ähnlichen symbiotischen Mikroorganismen könnten unser Bild vom Stammbaum des Lebens und den evolutionären Kräften, die ihn geprägt haben, nachhaltig verändern.

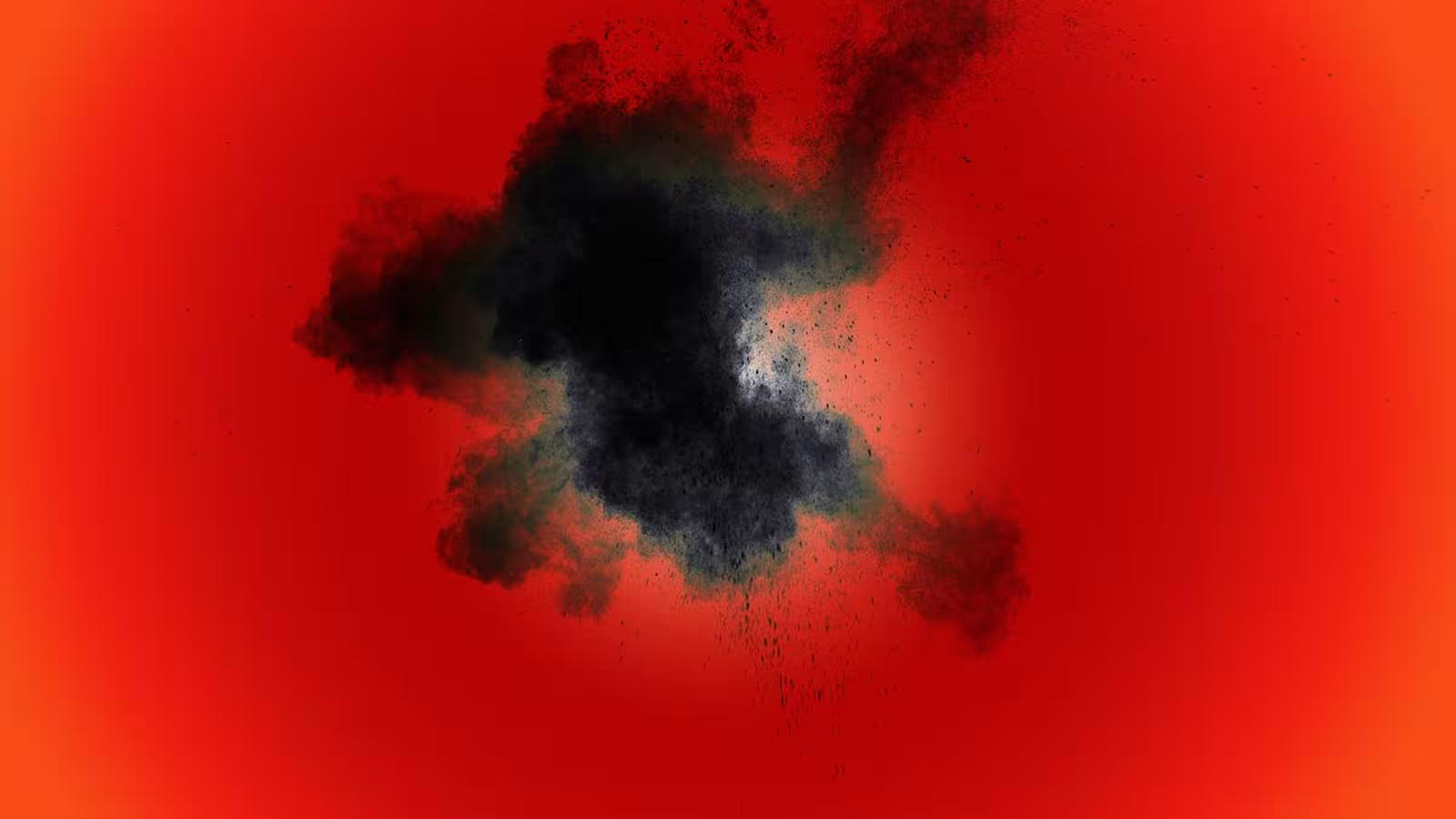
Kommentare